Forschungscampus Modal
"Der Forschungscampus als Brücke zwischen Forschung und Anwendung
Der Forschungscampus MODAL nutzt mathematische Modelle, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Ein Ziel, das die Tim Conrad und Hans Lamecker mittragen.
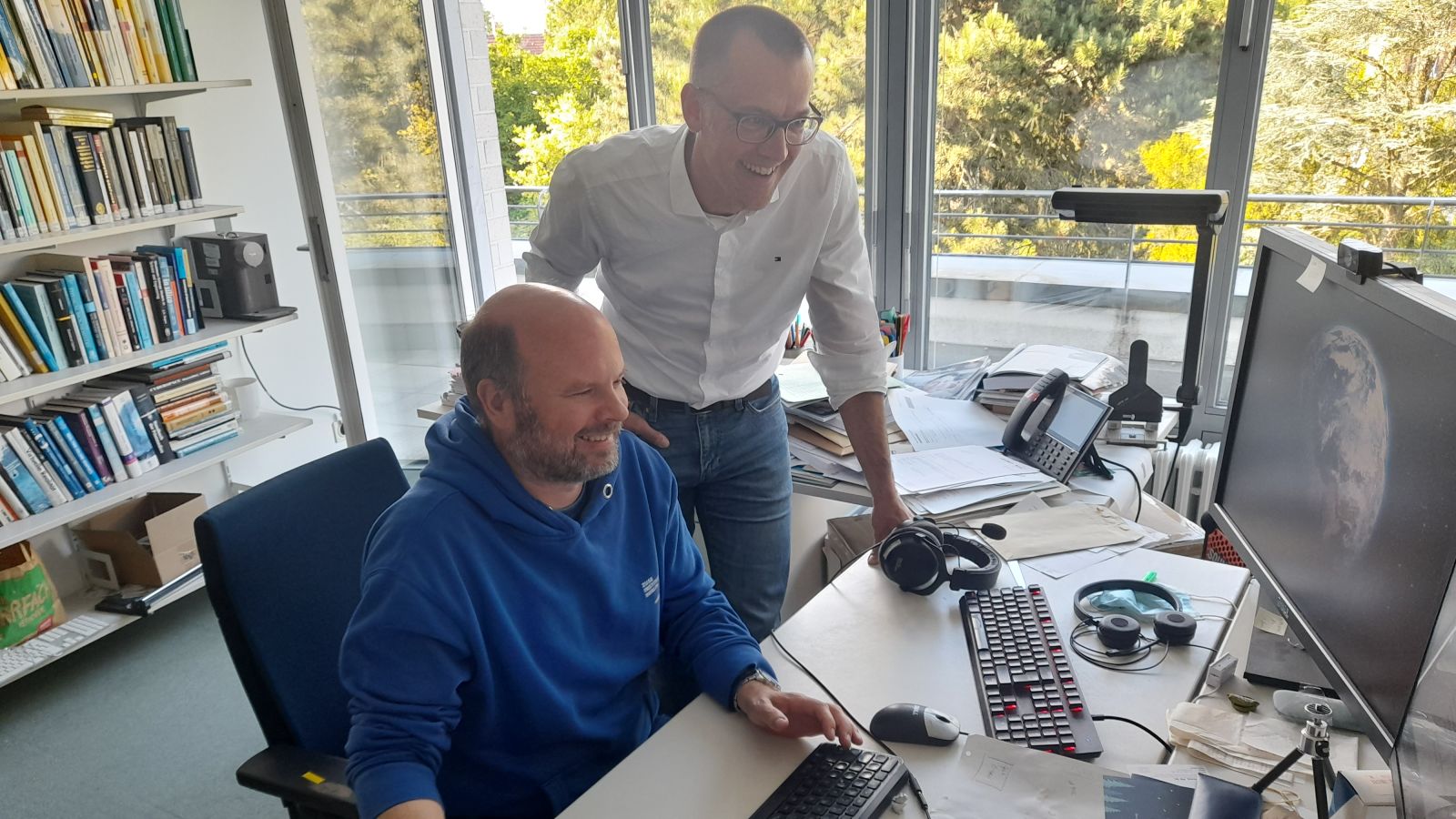
Dr. Hans Lamecker, 50 Jahre alt, ist Direktor für Softwareentwicklung bei der Stryker Berlin GmbH. Professor Tim Conrad, 46 Jahre alt, ist angestellt beim Zuse Institut Berlin (ZIB) und leitet das MedLab beim Forschungscampus MODAL. Dort bündelt der Forschungscampus seine medizinischen Themen. Beide teilen die Leidenschaft sich mit Hilfe von mathematischen Modellen mit Problemen der realen Welt zu beschäftigen - das zentrale Anliegen des Forschungscampus MODAL.
Wie sind Sie beide zu Ihrem Forschungsfeld gekommen?
Hans Lamecker: Ich bin definitiv ein Nerd. Ich habe mich immer für moderne Technologien interessiert, in der Kombination mit Mathematik. Ich habe Physik studiert, während meines Studiums im ZIB ein Praktikum gemacht. In der Verbindung aus Technologie und Entwicklung, aus Forschung und Anwendung habe ich für mich einen Sinn gefunden.
Tim Conrad: Am ZIB haben wir eigentlich immer schon versucht, mit Anwendungspartnern zu arbeiten. Als dann der Forschungscampus-Call kam, war das relativ dicht an dem, was wir sowieso gemacht hatten. Nicht so intensiv, nicht unter einem Dach, aber es gab Industriepartner, die wir getroffen haben. Dass wir heute direkt mit Industriepartnern sprechen, ihnen zeigen, was wir entwickelt haben und sofort Feedback bekommen: Diese wirklich kurzen Wege sind erst durch die Initiative „Forschungscampus“ entstanden.
Herr Conrad, Ihre Welt waren schon immer die Daten. Woher kommt Ihre Faszination dafür?
Tim Conrad: Daten bilden die Realität ab. Wir haben lange Daten vervielfältigt, damit wir genug hatten, um damit zu arbeiten. Das war immer nur eine Annäherung an die Realität. Die echte Realität kriegst du erst, wenn du wirklich am Menschen misst. Das Modell von Mathematikern ist häufig das von der perfekten Kugel. In der echten Welt ist es eher so, dass wir einen Klumpen bekommen, keine Kugel, und damit müssen wir arbeiten. Wenn wir Anwendungen für die echte Welt entwickeln wollen, müssen wir auch den Klumpen mitdenken.
Hans Lamecker: Wenn ich dir so zuhöre, teilen wir die Leidenschaft, uns mit Problemen zu beschäftigen, die real auftreten, nicht nur mit Modellproblemen. Wir beschäftigen uns mit Problemen, die ein Chirurg hat im OP-Saal, die ein Medikamentenhersteller hat, wenn er ein neues Medikament entwickeln will. Daten, die wir durch moderne Sensorik gewinnen, erlauben uns, wirklich an die echten Probleme ranzugehen.
Sie sind beide vom ersten Tag MODAL beim Forschungscampus dabei. Ist man damals auf Sie zugekommen und hat gefragt, ob Sie dazu Lust haben?
Tim Conrad: Ich glaube, die Gründungsväter und -mütter haben geschaut, in welche Richtung es gehen soll. Da stand Medizin schnell als ein Thema fest. Wir hatten schon starke Projekte und dann waren Leute wie wir gesetzt, weil wir diese Themen vertreten haben.
Hans Lamecker: Die Themen lagen auf der Hand, weil sie gesellschaftlich relevant waren und weil wir dazu mit informatisch-mathematischen Methoden wirklich einen Beitrag liefern können. Nicht nur auf Ebene der Methodenentwicklung, sondern im direkteren Feedback mit den Anwendern.
Tim Conrad: Zu denen gab es auch schon Beziehungen. Wir hatten schon Kontakte in Weltkonzerne, sodass wir mit der langfristigen Perspektive der Initiative „Forschungscampus“ da aufsatteln konnten. Das funktioniert ja nicht, wenn man anruft und sagt: Leute, ihr seid ein Weltkonzern, ihr kennt uns nicht, wir euch auch nicht, aber lasst uns für die nächsten zehn Jahre was zusammen machen. Wir hatten eine gute Grundlage und haben darauf aufgebaut.
Hans Lamecker: Für mich ist der Forschungscampus MODAL eigentlich eine Fortsetzung der Vision der Gründerväter des ZIB. Weil die Vision sozusagen mit jedem Projekt oder auch mit jedem Konsortium, was entstanden ist, weiterverfolgt wurde. Der Forschungscampus MODAL hat es erreicht, wirklich die für uns relevanten Stakeholder, Kliniker oder Industriepartner an einen Tisch zu bringen.

Was macht der Forschungscampus MODAL denn dann anders als das ZIB – wenn Sie sagen, dass dort vieles schon angelegt war?
Tim Conrad: Es ist Geld da. In einem Institut wie dem ZIB sind Industriepartner ja finanziell gar nicht mitgedacht. Das ist darauf ausgerichtet zu forschen. Da gibt es zwar ein Interesse, die Industrie einzubinden, aber das ist – anders als in der Initiative „Forschungscampus“ – nicht Teil der Förderung. Anders ist auch die Langfristigkeit der Initiative. Für forschungsorientierte Projekt haben wir sonst meist zwei, drei Jahre Zeit. In der Initiative „Forschungscampus“ sind es fünf bis fünfzehn Jahre. Das motiviert auch Industriepartner, sich langfristig zu engagieren.
Hans Lamecker: Es wird dadurch nachhaltig. Bei kürzeren Laufzeiten ist es total schwierig, darüber hinaus weiter an einem Thema zu arbeiten. So hat der Forschungscampus auch zur Ausgründung unserer Firma beigetragen. (Lamecker hat 2010 das Unternehmen 1000 Shapes gegründet. Es ist im Sommer 2024 vom internationalen Konzern Stryker gekauft worden.) Wir haben uns das auch deshalb zugetraut, weil wir wussten, dass wir nach der Ausgründung in so einem Netzwerk an Ressourcen kommen, die es uns ermöglichen, Innovationen weiterzubetreiben. Ein kleines Spin-off kann das nicht leisten.
Gibt es etwas, wo Sie sagen, das zeichnet die Arbeit oder die Zusammenarbeit des Miteinanders ans Forschungscampus aus?
Tim Conrad: Auf jeden Fall die Langfristigkeit oder Nachhaltigkeit, wie Hans sie genannt hat. Das zweite ist Vertraulichkeit: Diese Grundsatzidee, wir haben jetzt eine Kooperation, die ist erstmal durch NDAs (Non-Disclosure-Agreement oder Verschwiegenheitserklärung) und ähnliches, gedeckt. Wir können uns also Dinge erzählen, die wir uns im normalen Kontext nicht erzählen würden, aus Angst, dass jemand unsere Ideen klaut. Außerdem die viel beschworene „Augenhöhe in der Zusammenarbeit“ und das „Arbeiten unter einem Dach“. Am Anfang haben wir gedacht, das ist ein ganz komischer Slogan. Aber über die Zeit haben wir verstanden, was damit gemeint ist. Auch wenn wir jetzt nicht jede Minute unter diesem Dach sitzen, kann man wirklich sagen: Diese kurzen Wege gab es früher nicht. Jetzt arbeiten wir wirklich zusammen. Wenn Industriepartner Forschung fördern, heißt es sonst von denen schnell: Wir bezahlen, macht das so wie wir sagen. Das gibt es im Forschungscampus MODAL nicht. Das Framework, was das BMFTR mit der Initiative „Forschungscampus“ etabliert hat, macht vieles möglich.
Hans Lamecker: Ichwürde das noch mal unter „unbürokratisch“ subsumieren. Das liegt natürlich daran, dass wir, wie du es richtig sagst, Tim, am Anfang einen Rahmen geklärt haben. Ab da ist die Zusammenarbeit dann super-unbürokratisch. Ich kann eine ganze Reihe von Beispielen aufzählen, bei denen wir uns spontan mit Kolleginnen und Kollegen zusammengesetzt, ein Problem geschildert haben und dann hat sich eine Forscherin oder ein Forscher oder auch mehrere Forscher beim Forschungscampus MODAL damit beschäftigt. Ohne Ressourcenzuweisung oder ähnliches. Ganz konkret: In unserem Bereich gibt es immer wieder Wettbewerbe. Da wird ein Datensatz bereitgestellt, zum Beispiel CT-Daten vom menschlichen Körper. Die Aufgabe ist es, automatisch in diesem Datensatz bestimmte Strukturen zu finden und 3D-Modelle daraus zu extrahieren. Zum Beispiel bei Defekten am Schädel, um Rückschlüsse zu ziehen, wie der Schädel wohl vor dem Defekt ausgesehen hat. Wir wussten, beim Forschungscampus MODAL gibt es KI-Verfahren, die da funktionieren könnten. Wir haben ein Team gebildet aus Mitarbeitenden aus unserem Unternehmen und vom ZIB, haben ein paar Monate experimentiert und hatten dann einen Prototyp, den wir einreichen konnten. Ich glaube, wir haben den zweiten Platz gemacht. Fast wichtiger: Wir haben unheimlich viele Informationen da rausgezogen.
Ihnen geht es bei solchen Wettbewerben darum, neue Methodiken zu erschließen?
Hans Lamecker: Genau, das sind sozusagen Teile unserer Lösung. Bei Stryker entwickeln wir Implantate und Hilfsmittel für Implantate für die patientenspezifische Versorgung in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Das können Schädel- oder Knochenplatten sein, um Knochensegmente miteinander zu verschrauben. Eine neue Methodik liefert natürlich kein neues Implantat, aber wir wollen ja patientenspezifische Lösungen und die sollen möglichst skalierbar sein. Dazu müssen wir die Herstellung nach irgendeiner Methode automatisieren. Das sind genau die Stellen, wo wir dann mit dem Forschungscampus MODAL zusammenarbeiten. Das können wir alleine nicht leisten. Das Beispiel von dem eben beschriebenen Wettbewerb ist ganz akut Thema: Wir nehmen gerade die Forschungsergebnisse, die wir aus der Teilnahme an dem Wettbewerb gewonnen haben und überlegen, wie können wir die bei uns einbauen. Das ist einfach großartig. Da ist der Forschungscampus MODAL ein riesiger Wettbewerbsvorteil.
Gibt es ein Projekt, an dem Sie zwei gemeinsam arbeiten?
Hans Lamecker: Das hat sich auch aus dem Bereich entwickelt, den ich gerade skizziert habe. Wir arbeiten jetzt an bestimmten KI-Techniken für die Vorhersage von anatomischen Variationen. Das heißt, die KI-Technik soll in einem Datensatz erkennen, wie eine Anatomie aussehen muss, auch wenn sie nur zum Teil sichtbar ist oder defekt. Die Vorhersage könnten wir dann nutzen, um automatisiert, individualisierte Implantate zu fertigen. Nach einem Unfall zum Beispiel, wenn wirklich ein Stück Knochen fehlt.
Unsere Technologie von Stryker funktioniert gut für das, was wir momentan machen, die Rekonstruktion von verformten Knochen. Im Forschungscampus MODAL entwickeln wir die nächste Generation. Da geht es darum, dass etwas nicht nur verformt ist, sondern wirklich fehlt, weil der Krebs es weggefressen hat zum Beispiel. Vorherzusagen, wie dieses fehlende Stück aussah, das wir aufbauen wollen, ist der nächste Schritt.
Wie sieht Ihr Arbeitstag aus? Machen Sie morgens den Computer an und rechnen den ganzen Tag?
Tim Conrad: Ja, auch mit dem Bleistift und an der Tafel (lacht und zeigt auf ein Whiteboard). Etwa die Hälfte meiner Zeit bin ich mit administrativen Sachen beschäftigt: von Urlaubsanträge unterschreiben bis hin zu weitere Fördermittel beantragen. Zur anderen Hälfte, zur wissenschaftlichen Arbeit gehört es, im Blick zu behalten, was andere machen – also bei der Entwicklung der Forschung am Ball zu bleiben. Die eigentliche Forschung ist dann anders als im Fernsehen, wo jemand an einer Tafel steht, eine Idee hat, die aufschreibt und fertig ist. Das dauert im wahren Leben mehrere Monate oder Jahre. An der Grundidee arbeiten wir meist im Team. Jeder baut an einem kleineren Teil davon mit und irgendwann ist das große Ding fertig, man schreibt es auf und publiziert es im besten Fall.
Ist „das große Ding“ dann eine Rechnung oder eine Gleichung?
Tim Conrad: Meist sind das Anwendungsfälle. So ähnlich wie gerade beschrieben. Also zum Beispiel, eine Wirbelsäule mit Lücken. Wir wollen wissen, wie die fehlenden Wirbel aussahen – in 3D damit wir sie rekonstruieren können. Bestenfalls haben wir über eine Kooperation Bilddaten, die solche Defekte zeigen. Wir entwickeln dann einen Algorithmus, der das Modell bauen kann. Wir probieren monatelang aus, was es schon gibt. Wir stellen fest, warum das alles nicht funktioniert und was wir anders machen müssen und irgendwann klappt es dann.
Hans Lamecker: Sie können sich das wie ein Labor vorstellen, ein Rechenlabor. Das heißt, am Schluss führen wir wirklich Experimente durch – am Rechner. Wir stellen Hypothesen auf, leiten Verfahren ab und lassen die dann auf reale Daten los und dann evaluieren wir mit Hilfe von Referenzdaten.
Tim Conrad: Das können wir nur mit einem Industriepartner, über den wir an diese Daten kommen.
Hans Lamecker: Es gibt Ausnahmen, und das sind diese Wettbewerbe, von denen ich erzählt habe. Da stellen meist Universitätskliniken solche Daten bereit, für eine ganz spezifische Fragestellung. Deshalb nehmen wir da auch so gerne teil, weil wir sonst natürlich in der Regel keine Patientendaten verwenden dürfen.
Gab es bei Ihnen in der Forschung, im Forschungscampus oder Drumherum einen Aha-Moment, auf den Sie gerne zurückschauen?
Hans Lamecker: Das Beispiel von eben war mein Aha-Moment: Wie spontan sich so ein Team findet, was sich mit einem wirklich relevanten Problem beschäftigt und so schnell zusammen Ressourcen aufstellt, so fokussiert an was arbeitet und Ergebnisse bringt. Von denen wir zwar damals noch nicht genau wussten, wann wir die nutzen können. Aber jetzt nutzen wir sie. Ich bin wirklich happy, dass ich diesen ganzen Bogen miterleben kann.
Tim Conrad: Bei mir war es eher dieses Datending. Als wir zum ersten Mal mit einem großen Industriepartner zusammengearbeitet haben und innerhalb von Monaten gigantische Datenmengen hatten, weil der Industriepartner weltweit Leute bezahlt hat, die diese Daten erzeugt haben. Normalerweise hätten wir dafür jahrelang hunderte Leute angebettelt. Jetzt mit dem Forschungscampus und eben einem Weltkonzern als Industriepartner ging es in drei Monaten.
Gibt es Momente, in denen sie denken, das ist „typisch Forschungscampus“?
Tim Conrad: Offenen Gespräche auch mit wirklich großen Weltkonzernen. Das war neu für mich und ich habe manchmal gedacht: „Das ist ja irre! Der hat gerade zugegeben, dass etwas gar nicht läuft.“ Dass das passiert und selbstverständlich im Raum bleibt, das ist typisch Forschungscampus.
Hans Lamecker: Typisch Forschungscampus ist auch eine Herausforderung, in der wir inzwischen routiniert sind: Wir haben immer wieder Übersetzungsprobleme, weil wir eben auf der Brücke zwischen Forschung und Anwendung stehen. Wir sprechen immer wieder andere Sprachen. Das erfordert immer wieder einen Anlauf, sich gegenseitig auch die Terminologie zu erklären und die Sprache zu erklären.
Spielt der Forschungscampus für Sie eine Rolle, wenn es um Fachkräfte geht?
Hans Lamecker: Fürs Recruiting ist der Forschungscampus total relevant, ja. Wenn hier gute Leute sind, die Lust habensich in der Produktentwicklung weiterzuentwickeln, ist das für uns perfekt. Das ist mehrfach passiert bei 1000 Shapes (der Ausgründung, von Lamecker, die im Juni 2024 von Stryker gekauft wurde). Wir haben mehrfach Leute eingestellt, die vorher im Forschungscampus MODAL gearbeitet haben. Das war super. Die haben kaum Einarbeitungszeit gebraucht, weil die einfach schon in den Themen drin waren.
Tim Conrad: Das ist ein relevanter Punkt auch umgekehrt, indem der Forschungscampus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeiten gibt, auch in Unternehmen reinzuwachsen.
Herr Lamecker, können Sie etwas von der Forschungscampus-Kultur in Stryker, in das internationale Unternehmen mit einbringen?
Hans Lamecker: Also ich versuch's, aber es ist tatsächlich schon eine andere Welt. Und das ist für mich gleichzeitig die Daseinsberechtigung des Forschungscampus MODAL, weil hier Welten aufeinandertreffen, die unterschiedliche Interessen verfolgen. Stryker ist ein Wirtschaftsunternehmen, was den Aktionären jedes Jahr eine zweistellige Wachstumsrate verspricht. In der Forschung ist das Interesse Erkenntnisse zu gewinnen, zu publizieren und der Welt zur Verfügung zu stellen. Der Forschungscampus MODAL ist für mich der Brückenbauer dazwischen. Natürlich stehen wir auch im Unternehmen unter Innovationsdruck. Unsere Kunden erwarten neue Produkte, neue Produkt-Features. Und wir wollen die idealerweise vor Wettbewerbern liefern. Den Innovationsgedanken, den wir im Forschungscampus MODAL verfolgen, frei an Anwendungsfragen forschen zu können, den trage ich natürlich auch in den Konzern. Im Sinne von, lasst uns das nutzen, lasst uns davon profitieren. Da ecke ich manchmal noch an, aber das ist schon auch meine Mission, diese Brücke zu bauen und den Konzern davon zu überzeugen, dass wir davon profitieren können.


